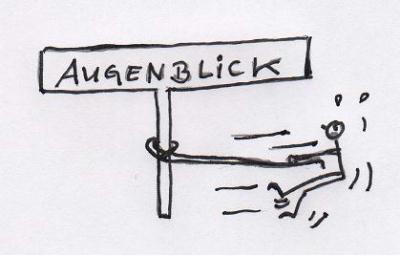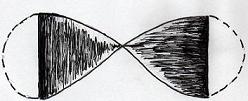Seiend-Struktur als sichtbarendes Werden?
Das Sein des Seienden sichtbart sich nicht selbst. Erklärend helfen nicht die Wörter „Hintergrund vs. Vordergrund“, welche nahe liegen würden, wenn etwas sichtbar und ein anderes unsichtbar ist. Das Werden ‚agiert’ nicht im Hintergrund, da es beides zugleich ist, „Hintergrund und Vordergrund“ – in eins gedacht (um doch mit diesen Wörtern ein Bild zu schaffen!).
Denke man an die Kraft, die manchen Menschen zur vollen Verfügung steht, auch sehr schwierige Vorhaben durchzubringen. Diese Menschen erscheinen ‚besonders’, weil sie Werke umsetzen und intensiver ‚leben’ als andere. Was zeichnet diese Menschen aus? Woher kommt diese Kraft, die ihnen diese besondere Ausstrahlung verleiht? Es ist eine bestimmte Kraft, die sich gründend zeigt und begründend diese Menschen treibt. Diese Kraft ist nicht als „einmaliges Feuern“ zu verstehen, sondern sie wirkt durchgängig, sie ist anwesend und begründend zugleich. Die Art und Weise, wie sich diese Kraft durchsetzen kann, bestimmt wie etwas erscheint. (Z.B. erscheint etwas/ein Vorhaben schwach oder stark, dauerhaft oder wechselhaft, punktuell oder gestreut?) Hier kann sich jeder selbst fragen und für sich beantworten, inwieweit die gründende Kraft bei ihm selbst durchkommt, inwieweit er sie durch- und wirken lässt. Durch Filter der Erziehung und Erfahrungen werden die Möglichkeiten, dass sich die Kraft in aller Hinsicht entfalten kann, eingeschränkt. So kann es sein, dass sich die Kraft nur in kleinen Fitzelchen sichtbaren kann. Das Werden ist kanalisiert und wird beschränkt. Auch, wenn es mit voller Wucht da ist, wie in Allem, wird es nur an manchen Stellen ‚durchgelassen’. Vielleicht steht die Anzahl dieser ‚durchlässigen Stellen’ in Relation zu unseren ‚Einstellungen’ und dadurch geschaffenen Vorurteilen.
Menschen, die das Werden des Werdenden zulassen, haben reich davon, da ihnen mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Reichtum eines Menschen ist also ein Zeichen dafür, wie groß seine Fähigkeit ist, das Werden wirken zu lassen.

(A. Köster)
Das Wesen des Wesenden lässt sich durch die Art und Weise ausmachen, wie sich das Werden durchsetzt bzw. entfaltet. Die Art und Weise lässt sich strukturell ausmachen. Durch die Struktur des Erscheinenden, wird die Kraft (das Werden) sichtbar, die es antreibt. Denn das Durchscheinen des Seins des Seienden der Dinge als das Werden zeigt sich, wenn etwas auf gleiche oder ähnliche Weise wird. Es geht nicht um das Einzelne, das wird und wie es wird, sondern um das allem Werden Gemeinsame, welches in allem anwest.
Denke man an die Kraft, die manchen Menschen zur vollen Verfügung steht, auch sehr schwierige Vorhaben durchzubringen. Diese Menschen erscheinen ‚besonders’, weil sie Werke umsetzen und intensiver ‚leben’ als andere. Was zeichnet diese Menschen aus? Woher kommt diese Kraft, die ihnen diese besondere Ausstrahlung verleiht? Es ist eine bestimmte Kraft, die sich gründend zeigt und begründend diese Menschen treibt. Diese Kraft ist nicht als „einmaliges Feuern“ zu verstehen, sondern sie wirkt durchgängig, sie ist anwesend und begründend zugleich. Die Art und Weise, wie sich diese Kraft durchsetzen kann, bestimmt wie etwas erscheint. (Z.B. erscheint etwas/ein Vorhaben schwach oder stark, dauerhaft oder wechselhaft, punktuell oder gestreut?) Hier kann sich jeder selbst fragen und für sich beantworten, inwieweit die gründende Kraft bei ihm selbst durchkommt, inwieweit er sie durch- und wirken lässt. Durch Filter der Erziehung und Erfahrungen werden die Möglichkeiten, dass sich die Kraft in aller Hinsicht entfalten kann, eingeschränkt. So kann es sein, dass sich die Kraft nur in kleinen Fitzelchen sichtbaren kann. Das Werden ist kanalisiert und wird beschränkt. Auch, wenn es mit voller Wucht da ist, wie in Allem, wird es nur an manchen Stellen ‚durchgelassen’. Vielleicht steht die Anzahl dieser ‚durchlässigen Stellen’ in Relation zu unseren ‚Einstellungen’ und dadurch geschaffenen Vorurteilen.
Menschen, die das Werden des Werdenden zulassen, haben reich davon, da ihnen mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Reichtum eines Menschen ist also ein Zeichen dafür, wie groß seine Fähigkeit ist, das Werden wirken zu lassen.

(A. Köster)
Das Wesen des Wesenden lässt sich durch die Art und Weise ausmachen, wie sich das Werden durchsetzt bzw. entfaltet. Die Art und Weise lässt sich strukturell ausmachen. Durch die Struktur des Erscheinenden, wird die Kraft (das Werden) sichtbar, die es antreibt. Denn das Durchscheinen des Seins des Seienden der Dinge als das Werden zeigt sich, wenn etwas auf gleiche oder ähnliche Weise wird. Es geht nicht um das Einzelne, das wird und wie es wird, sondern um das allem Werden Gemeinsame, welches in allem anwest.
rahelrath - 22. Mai, 18:20
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks